Debian Versionsupdate: Buster nach Bullseye
veröffentlicht am 22.10.2022 mit 2603 Worten - Lesezeit: 13 Minute(n) in * LINUX *
Inhaltsverzeichnis
Ausgehend von diesen Überlegungen steht - eigentlich bereits “über die Zeit” - ein Versionsupdate meines Debian-Systems an.
Grundlegendes
Das prinzipielle Vorgehen wird hier auf den Seiten von Debian beschrieben. Die Darstellung ist sehr umfangreich, vieles davon für den “normalen Desktop-User” nicht zwingend erforderlich. Ich beschreibe hier meine Voraussetzungen und die daraus resultierenden Schritte für meine Rechner.
Ausgangssituation
Zunächst mache ich eine Bestandsaufnahme: Was ist wie installiert auf diesem Rechner? Dazu hilft ein Blick in die Paketquellen:
Da gibt es zunächst die offiziellen Debian-Repostitories:

aber auch zusätzliche Quellen:

Bei mir sind das die ebenfalls von Debian bereitgestellten Backports (wo es die eine oder andere neuere Version von Software gibt, die auf das “alte” Buster zurückportiert wurde - für mich ist hier in erster Linie QMapshack und gnucash/aqbanking interessant).
Weiterhin habe ich aber auch ein lokales Repository auf dem Rechner selbst aufgebaut, wo ich verschiedene (tlw. selbst generierte, tlw. von den Entwicklern bereitgestellte) Debian-Installationspakete bereithalte. Die Struktur dieses lokalen Repository folgt den Beschreibungen von der Debian-Seite:
/var/local/repository$ tree -ad
.
└── dists
├── bullseye
│ ├── contrib
│ │ └── binary-amd64
│ ├── main
│ │ └── binary-amd64
│ └── non-free
│ └── binary-amd64
└── buster
├── contrib
│ └── binary-amd64
├── main
│ └── binary-amd64
└── non-free
└── binary-amd64
15 directories
Wie man aus dem Verzeichnisbaum sieht, hab ich hier Unterverzeichnisse für die jeweiligen Distributionen angelegt und dort jeweils die entsprechenden Pakete hineinkopiert. Das ist für das eigentliche Update nachher noch wichtig.
Bis hierher ist das ein sehr ‘zahmes’ Setup. Ein Update sollte daher relativ unproblematisch sein.
Nebenbemerkung: ich habe an anderer Stelle mal die Installation der jeweils neuesten darktable-Version aus dem github-Repostory der Entwickler beschrieben. Durch die Verwendung von checkinstall habe ich auch hier keine Handinstallation, sondern das kreierte Debian-Paket wird über das obige lokale Repository in den Paketmechanismus des Systems eingeschleust.
Vorgehensweise
“Inventur”
Zunächst stelle ich sicher, daß auf der Maschine wirklich die letzte Version von Debian läuft (ja, auch ich werde älter 😄)
~$ cat /etc/debian_version
10.13
Dann schaue ich nach, welche Pakete Debian als “nicht-eigene” Pakete anzeigt. Debian gibt dazu die folgenden beiden (alternativen) Befehle an (aptitude mußte ich dazu erst installieren, ebenso apt-forktracer):
~# aptitude search '?narrow(?installed, ?not(?origin(Debian)))'
idA libmicrodns0 - minimal mDNS resolver and announcer librar
i lightning-l10n-de - German language package for lightning - Tr
und
~# apt-forktracer | sort
aqbanking-tools (6.2.10-1~bpo10+1) [Debian Backports: 6.2.10-1~bpo10+1] [Debian: 5.7.8-3]
gnucash (1:4.4-1~bpo10+2) [Debian Backports: 1:4.4-1~bpo10+2] [Debian: 1:3.4-1+deb10u1]
gnucash-common (1:4.4-1~bpo10+2) [Debian Backports: 1:4.4-1~bpo10+2] [Debian: 1:3.4-1+deb10u1]
libaqbanking44 (6.2.10-1~bpo10+1) [Debian Backports: 6.2.10-1~bpo10+1]
libaqbanking-data (6.2.10-1~bpo10+1) [Debian Backports: 6.2.10-1~bpo10+1] [Debian: 5.7.8-3]
libgwengui-gtk3-79 (5.6.0-2~bpo10+1) [Debian Backports: 5.6.0-2~bpo10+1]
libgwenhywfar79 (5.6.0-2~bpo10+1) [Debian Backports: 5.6.0-2~bpo10+1]
libgwenhywfar-data (5.6.0-2~bpo10+1) [Debian Backports: 5.6.0-2~bpo10+1] [Debian: 4.20.0-9]
libmicrodns0 (0.0.10-1)
lightning-l10n-de (1:78.14.0-1~deb10u1)
qmapshack (1.15.2-1~bpo10+1) [Debian Backports: 1.15.2-1~bpo10+1] [Debian: 1.12.3-1]
An dieser Stelle beschließe ich, die Ergebnisse erstmal zu ignorieren, denn:
- mir ist unklar, warum
lightning-l10n-de (1:78.14.0-1~deb10u1)gelistet ist, wenn hier ein ganz normaler Thunderbird in der aktuellen Version
läuft~# thunderbird --version Thunderbird 102.3.0 - die anderen Pakete stammen alle aus den Backports, und solche gibt es auch für
bullseye. Dort ist aber - bezogen auf meine Pakete - nur nochqmapshackvon Interesse, die Banking-Tools kommen dort nicht mehr vor. Werde also mal sehen, was da passiert.
Update - Vorbereitungen
-
letzten Stand sicherstellen
Das sollte der Fall sein, wenn diese Einstellungen gewählt sind:
-
veraltete Pakete
Hier erscheinen~# aptitude search '~o' idA libmicrodns0 - minimal mDNS resolver and announcer library (shared library) i lightning-l10n-de - German language package for lightning - Transitional packagezwei der obigen “alten Bekannten” wieder, aber beim Entfernen mit dem folgenden Befehl
~# aptitude purge '~o' Die folgenden Pakete werden ENTFERNT: libaqbanking35{u} libaqbanking35-plugins{u} libaqebics0{u} libaqhbci24{u} libaqofxconnect7{u} libflickcurl0{u} libgwenhywfar60{u} libktoblzcheck1v5{u} libmicrodns0{pu} libxmlsec1-gcrypt{u} libxmlsec1-gnutls{u} lightning-l10n-de{p} python-configparser{u} python-entrypoints{u} python-keyring{u} python-lockfile{u} python-secretstorage{u} python-squaremap{u} 0 Pakete aktualisiert, 0 zusätzlich installiert, 18 werden entfernt und 0 nicht aktualisiert. 0 B an Archiven müssen heruntergeladen werden. Nach dem Entpacken werden 7.300 kB frei werden.werden etliche weitere Pakete zum Entfernen vorgeschlagen. Dem gebe ich hier statt:
(Lese Datenbank ... 335640 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.) Entfernen von libaqbanking35-plugins:amd64 (5.7.8-3) ... Entfernen von libaqofxconnect7:amd64 (5.7.8-3) ... Entfernen von libaqhbci24:amd64 (5.7.8-3) ... Entfernen von libaqebics0:amd64 (5.7.8-3) ... Entfernen von libflickcurl0:amd64 (1.26-4) ... Entfernen von libktoblzcheck1v5:amd64 (1.49-5) ... Entfernen von libmicrodns0:amd64 (0.0.10-1) ... Entfernen von libxmlsec1-gnutls:amd64 (1.2.27-2) ... Entfernen von libxmlsec1-gcrypt:amd64 (1.2.27-2) ... Entfernen von lightning-l10n-de (1:78.14.0-1~deb10u1) ... Entfernen von python-keyring (17.1.1-1) ... Entfernen von python-entrypoints (0.3-1) ... Entfernen von python-configparser (3.5.0b2-1) ... Entfernen von python-lockfile (1:0.12.2-2) ... Entfernen von python-secretstorage (2.3.1-2) ... Entfernen von python-squaremap (1:1.0.4-2) ... Entfernen von libaqbanking35:amd64 (5.7.8-3) ... Entfernen von libgwenhywfar60:amd64 (4.20.0-9) ... Trigger für libc-bin (2.28-10+deb10u1) werden verarbeitet ...denn eine Stichprobe
# dpkg -l | grep aqbanliefert das Ergebnis, daßaqbankingin der Version6.2.10-1~bpo10+1installliert ist, also deutlich neuer als die entfernte Version -
alte Konfigurationsdateien
Hier wird vorgeschlagen, diese zu entfernen. Viel ist auf meinem System hier nicht “zu holen”:~# find /etc -name '*.dpkg-*' -o -name '*.ucf-*' -o -name '*.merge-error' /etc/ca-certificates.conf.dpkg-oldalso:
~# rm /etc/ca-certificates.conf.dpkg-old -
proposed updates
Es wird ausdrücklich empfohlen, diese Option zu deaktivieren vor dem Update:

- Paketstatus überprüfen
der hierzu vorgeschlagene Befehldpkg --auditliefert bei mir keine Ausgabe, scheint also alles gut zu sein. Falls nicht, gibt es hier eine Liste von Vorgehensweisen, dem abzuhelfen.
Backup
Hier nutze ich das mitgelieferte Timeshift so eingestellt, daß Boot- und Systempartition sowie Einstellungen/versteckte Ordner der Home-Partition des Hauptbenutzers gesichtert werden.
Quellen ändern
Wer anschließend nachvollziehen möchte, welche Pakete im einzelnen hinzugefügt oder entfernt wurden während des Updates, der kann jetzt diesen Abschnitt lesen.
Anhand der oben beschriebenen Repositories müssen jetzt die Quellen auf die neuere Distribution angepaßt werden, dies geschieht in den APT source-list-Dateien (/etc/apt/sources.list und Dateien in /etc/apt/sources.list.d/).
Hier sieht das bei mir so aus:
Die Datei sources.list zeigt den folgenden Inhalt, während der Ordner /etc/apt/sources.list.d/ leer ist.
#------------------------------------------------------------------------------#
# OFFICIAL DEBIAN REPOS
#------------------------------------------------------------------------------#
# deb cdrom:[Debian GNU/Linux 10.3.0 _Buster_ - Official amd64 NETINST 20200208-12:07]/ buster main
# deb cdrom:[Debian GNU/Linux 10.3.0 _Buster_ - Official amd64 NETINST 20200208-12:07]/ buster main
deb http://deb.debian.org/debian/ buster main contrib non-free
deb-src http://deb.debian.org/debian/ buster main contrib non-free
deb http://security.debian.org/debian-security buster/updates main contrib non-free
deb-src http://security.debian.org/debian-security buster/updates main contrib non-free
# buster-updates, previously known as 'volatile'
deb http://deb.debian.org/debian/ buster-updates contrib main non-free
# This system was installed using small removable media
# (e.g. netinst, live or single CD). The matching "deb cdrom"
# entries were disabled at the end of the installation process.
# For information about how to configure apt package sources,
# see the sources.list(5) manual.
# buster-backports
deb http://deb.debian.org/debian buster-backports main
#------------------------------------------------------------------------------#
# LOCAL REPOS
#------------------------------------------------------------------------------#
###### Lokal erstellte oder heruntergeladene .deb-Files
deb [trusted=yes] file:///var/local/repository buster main contrib non-free
Gemäß Beschreibung tausche ich zunächst überall buster gegen bullseye aus. Im nächsten Schritt folge ich der Anweisung in Kap. 5.1.3 der Release-Notes und passe das Benennungsschema der Sicherheitsupdates an.
Eine genauere Beschreibung der Quellen findet sich im Wiki.
Nach etwas “Aufräumen” (die Hinweise zur netinstall-CD werden nicht mehr benötigt) sieht die Datei dann so aus:
#------------------------------------------------------------------------------#
# OFFICIAL DEBIAN REPOS
#------------------------------------------------------------------------------#
deb http://deb.debian.org/debian bullseye main contrib non-free
deb-src http://deb.debian.org/debian bullseye main contrib non-free
deb http://deb.debian.org/debian-security/ bullseye-security main contrib non-free
deb-src http://deb.debian.org/debian-security/ bullseye-security main contrib non-free
# bullseye-updates - see https://wiki.debian.org/StableUpdates
deb http://deb.debian.org/debian bullseye-updates main contrib non-free
deb-src http://deb.debian.org/debian bullseye-updates main contrib non-free
# bullseye-backports
deb http://deb.debian.org/debian bullseye-backports main contrib non-free
deb-src http://deb.debian.org/debian bullseye-backports main contrib non-free
#------------------------------------------------------------------------------#
# LOCAL REPOS
#------------------------------------------------------------------------------#
###### Lokal erstellte oder heruntergeladene .deb-Files
deb [trusted=yes] file:///var/local/repository bullseye main contrib non-free
update durchführen
Paketquellen aktualisieren
Zunächst werden die neuen Paketquellen eingelesen:
~# apt update
Holen:1 file:/var/local/repository bullseye InRelease
Ign:1 file:/var/local/repository bullseye InRelease
Holen:2 file:/var/local/repository bullseye Release [3.315 B]
Holen:2 file:/var/local/repository bullseye Release [3.315 B]
Holen:3 file:/var/local/repository bullseye Release.gpg
Ign:3 file:/var/local/repository bullseye Release.gpg
OK:4 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
OK:5 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
OK:6 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
OK:7 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
Paketlisten werden gelesen... Fertig
Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut.
Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig
Aktualisierung für 2393 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
Pakete aktualisieren
Das ist ’ne Menge, was da zu aktualisieren ist. Ich gehe zunächst in zwei Schritten gemäß der Beschreibung vor, hier der Erste:
~# apt upgrade --without-new-pkgs
und dieser Befehl meldet zurück:
1238 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 1155 nicht aktualisiert.
Es müssen noch 1.082 MB von 1.140 MB an Archiven heruntergeladen werden.
Nach dieser Operation werden 242 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
und nach dem Teilupdate meldet
~# cat /etc/debian_version
11.5
bereits das Upgrade auf die aktuelle Debian-Version 11 Bullseye.
Ein Paketvergleich zu diesem Zeitpunkt zeigt in der Tat, daß keine Pakete entfernt oder hinzugefügt wurden, lediglich an einigen Stellen wurde die Benennung geändert, immer nach diesem Schema:
aus libcdt5 wurde libcdt5:amd64 etc.
Im nächsten Schritt prüfe ich noch den Hinweis aus der Anleitung bzgl. Kernel-Updates:
Wenn Sie ein Distributions-Upgrade mit (apt full-upgrade) von Buster auf Bullseye durchführen, wird dringend empfohlen, ein linux-image-*-Metapaket zu installieren, falls noch nicht geschehen. Diese Metapakete werden während des Upgrade-Prozesses automatisch eine neue Kernel-Version installieren. Ob Sie eins installiert haben, können Sie verifizieren mit:
~# dpkg -l "linux-image*" | grep ^ii | grep -i meta
ii linux-image-amd64 4.19+105+deb10u17 amd64 Linux for 64-bit PCs (meta-package)
Das Kernel-Image-Metapaket ist installiert, somit kann jetzt
~# apt full-upgrade
erfolgen mit dem Ergebnis
1151 aktualisiert, 550 neu installiert, 158 zu entfernen und 2 nicht aktualisiert.
Es müssen noch 3.968 MB von 3.975 MB an Archiven heruntergeladen werden.
Nach dieser Operation werden 4.354 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
An dieser Stelle starte ich den Rechner neu um zu sehen, ob auch der Boot-Vorgang (noch) problemlos funktioniert …
Erste Checks
Softwarequellen und Updates
Nach dem ersten (erfolgreichen) Neustart hab ich zunächst die ganz oben schon gezeigten Software-Quellen und Update-Einstellungen geprüft:
Hauptquellen: wie gehabt:

Zusätzliche Quellen: Security, Backports und lokales Repo ok:

Und dann die Updates:
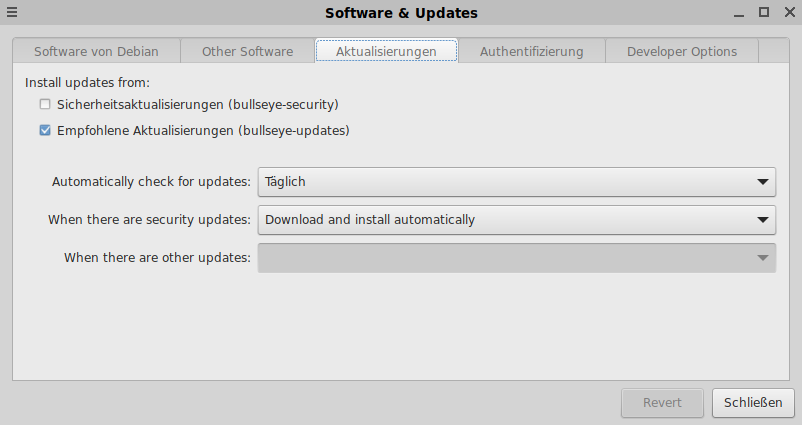
Hier sind die Sicherheitsupdates nicht für die automatische Aktualisierung aktiviert, das hab ich geändert:

Programme und deren Funktionalitäten
Im zweiten Schritt hab ich mir dann diejenigen Programme angeschaut, die
- mir am Wichtigsten sind und
- am Ehesten Probleme der einen oder anderen Art verursachen könnten
Und das wären dann:
-
Hugo
Logischerweise muß ich als Author dieser Seiten, der einen Artikel über ein Systemupdate schreibt, erstmal checken, ob der überhaupt zu erstellen und veröffentlichen ist 😄.
Hugo wurde durch den Wechsel vonBusteraufBullseyevon der Version0.64.1auf0.80angehoben. Ein ersteshugo server -w --disableFastRenderzeigt mir die Vorschau dieser Homepage ohne Fehler(meldungen). Das ist erstmal gut so, denn in der Vergangenheit haben Versionsupdates gerne mal zu Inkompatiblitäten der erstellten Templates geführt. -
darktable
Da gibt es in verschiedenen Modulen in darktable teils sehr lange Auswahllisten, die über die Bildschirmhöhe hinausreichen (z. B. die Auswahlliste der Nikon-Objektive in der Objektivkorrektur). Die nicht sichtbaren Einträge waren nicht erreichbar, durch die Aktualisierung der Cinnamon-Desktop-Komponenten durch das Versionsupdate nach Bullseye können diese Einträge nun durch Scrollen erreicht und angezeigt werden. -
gnucash/aqbanking
Hier ist mir v. a. die Funktion wichtig, Kontobewegungen direkt abrufen und importieren zu können (FinTS). Das funktioniert. -
qmapshack
Mein GPS-Track/Routing/Dokumentations-Tool. Selbe Version wie in Buster, scheint zu laufen. Dazu wird’s hoffentlich hier mal noch einen ausführlichen Beitrag über die Einrichtung und daraus resultierenden Möglichkeiten des Tools geben …
Grundsätzlicher Überblick der Aktualisierungen
Wer sich dafür interessiert, was im Detail durch das Versionsupgrade alles “passiert” ist, der kann so vorgehen (als User, nicht:
-
Paketlisten erzeugen vor dem Update/Upgrade:
~$ dpkg --get-selections "*" > ~/buster.txt -
Paketlisten erzeugen nach dem Update/Upgrade:
~$ dpkg --get-selections "*" > ~/bullseye.txt -
diese Listen in einem geeigneten Programm wie z. B. Meld einem Vergleich unterziehen:
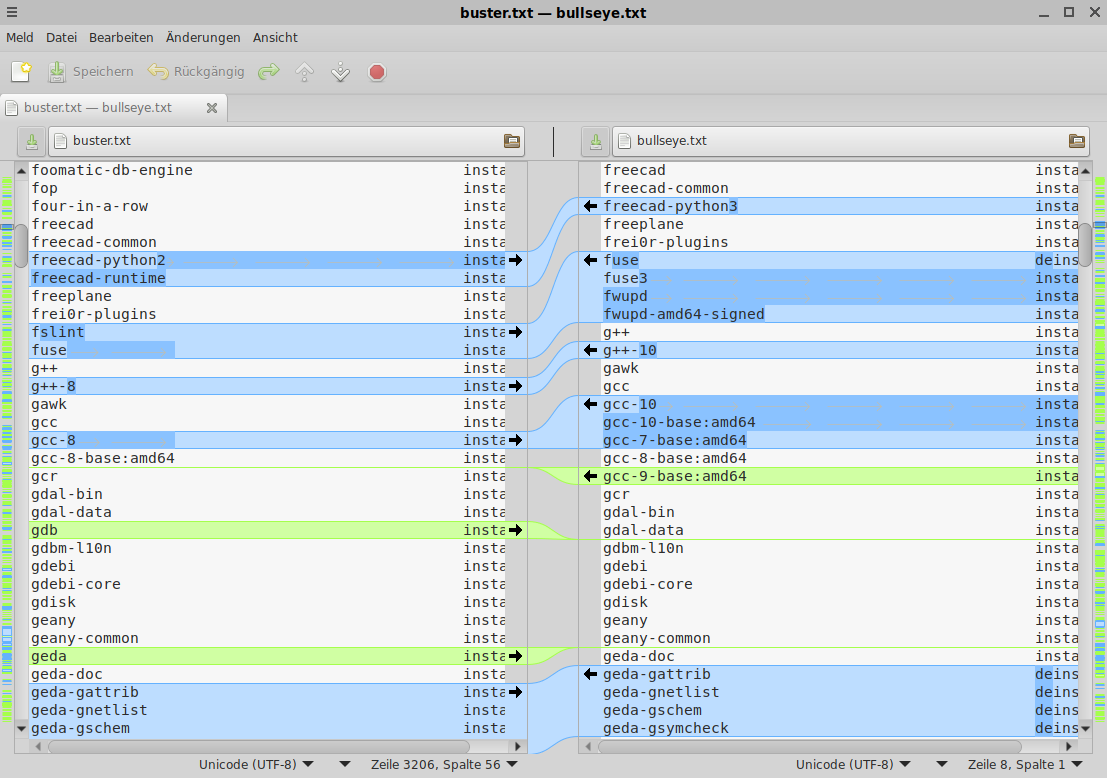
Das von mir verwendete Programm Meld ermöglicht es, diese Analyse als “Patch” abzuspeichern, die so erstellte Datei kann dann in einer Tabellenkalkulations-Software entsprechend gefiltert und gesichtet werden.
Und was stelle ich dabei fest: Etliche Programme sind schlicht “abhanden gekommen”:
- (darktable master: verschwindet logischerweise, wenn das Paket selbst gebaut, dann mit
dpkginstalliert wird und nicht in einem Repository enthalten ist) - fslint: Das Paket ist nicht mehr verfügbar (offenbar wg. Abhängigkeit von Python 2). Hier werde ich
rmlint-guitesten (im Menü als Shredder gelistet). - webcheck: Das Paket ist nicht mehr verfügbar (ebenfalls offenbar wg. Abhängigkeit von Python 2). Eine Alternative könnte linkchecker sein.
- geda-gattrib, geda-gnetlist, geda-gschem, geda-gsymcheck, geda-utils, geda-xgsch2pcb
- gnucash: warum, das weiß ich nicht, konnte ganz einfach wieder nachinstalliert werden:
apt install gnucash - inkscape: warum, das weiß ich nicht, konnte ganz einfach wieder nachinstalliert werden:
apt install inkscape
- taskcoach: der Versuch, das Programm händisch nachzuinstallieren, scheitert wegen nicht erfüllbarer Abhängigkeiten
Das wäre ggf. ein Fall für ein appimage(?)Die folgenden Pakete haben unerfüllte Abhängigkeiten: taskcoach : Hängt ab von: python-wxgtk3.0 (>= 3.0.0.0) ist aber nicht installierbar
Nacharbeiten
Verwaiste Konfigurationsdateien
In der Anleitung wird vorgeschlagen, die Installation auf Konfigurationsdateien zu überprüfen, deren zugehörige Pakete nicht mehr vorhanden sind. Das zeigt hier folgendes Ergebnis:
~# dpkg -l | awk '/^rc/ { print $2 }'
fuse
geda-gattrib
geda-gnetlist
geda-gschem
geda-gsymcheck
geda-utils
geda-xgsch2pcb
grub-efi-amd64
libapache2-mod-wsgi
libktoblzcheck1v5:amd64
linux-image-4.19.0-10-amd64
linux-image-4.19.0-11-amd64
linux-image-4.19.0-12-amd64
linux-image-4.19.0-13-amd64
linux-image-4.19.0-14-amd64
linux-image-4.19.0-16-amd64
linux-image-4.19.0-17-amd64
linux-image-4.19.0-18-amd64
linux-image-4.19.0-19-amd64
linux-image-4.19.0-20-amd64
linux-image-4.19.0-21-amd64
linux-image-4.19.0-8-amd64
linux-image-4.19.0-9-amd64
python
python-pygments
python-twisted
python-twisted-core
taskcoach
Hier habe ich mich dazu entschlossen alle diese Dateien zu entfernen.
~# apt purge $(dpkg -l | awk '/^rc/ { print $2 }')
Grund: die geda-(CAD-)Suite ist im Repository nicht mehr vorhanden, taskcoach kann wegen fehlender Abhängigkeit nicht installiert werden. Die Kernel-Configs beziehen sich auf ältere Kernel, aktuell in Bullseye nach dem Update wird Kernel 5.10.0-18-amd64 x86_64 verwendet.
Veraltete Pakete
Die Bezeichnung “veraltete Pakete” meint solche Pakete, die nicht mehr in einem der Repositories vorhanden sind. Auch das gibt eine lange Liste:
~# aptitude search '~o'
i A gcc-7-base - GCC, the GNU Compiler Collection (base package)
i gcc-8-base - GCC, the GNU Compiler Collection (base package)
i libapt-inst2.0 - deb package format runtime library
i libapt-pkg5.0 - package management runtime library
i libdns-export1104 - Exported DNS Shared Library
i A libexiv2-14 - EXIF/IPTC/XMP metadata manipulation library
i libffi6 - Foreign Function Interface library runtime
i libgcc1 - GCC support library
i libhogweed4 - low level cryptographic library (public-key cryptos)
i libip4tc0 - netfilter libip4tc library
i libip6tc0 - netfilter libip6tc library
i libisc-export1100 - Exported ISC Shared Library
i libjson-c3 - JSON manipulation library - shared library
i libnettle6 - low level cryptographic library (symmetric and one-way cryptos)
i libprocps7 - library for accessing process information from /proc
i A libwxgtk3.0-0v5 - wxWidgets Cross-platform C++ GUI toolkit (GTK+ runtime)
i A libxfce4ui-1-0 - widget library for Xfce - Gtk+2 variant
i A libxfconf-0-2 - Client library for Xfce4 configure interface
i A linux-image-4.19.0-22-amd64 - Linux 4.19 for 64-bit PCs (signed)
i perl-modules-5.28 - Core Perl modules
i spek - acoustic spectrum analyser
i A ufraw-batch - batch importer for raw camera images
i an erster Stelle in der ersten Spalte der Liste sagt: das Paket ist installiert. A an dritter Stelle sagt: die Installation erfolgte automatisch.
Die gelisteten Pakete wären mit
~# aptitude purge '~o'
zu entfernen … aber das will ich mir erstmal noch in Ruhe anschauen. spek beispielsweise würde ich vorerst gerne mal behalten … da könnte ich mir vorstellen, das in das eigene lokale Repository zu verschieben, solange das noch funktioniert.
Das Gute am Upgrade 😕
Das Paket roger-router ist wieder da: es bietet Direktzugriff auf eine Fritz!box und - wir sind ja in Deutschland 😉 - stellt einen Faxdrucker zur Verfügung … - aber das Schlechte daran ist, daß der Einrichtungsassistent abstürzt 😦 und ich einstweilen die dabei erstellten Konfigurationsdateien nicht finde (die muß es aber geben, denn am Anfang wird ein Profilname erfragt, der sich nach dem Absturz nicht ein zweites Mal eingeben läßt).
Außerdem lerne ich bei der Gelegenheit gleich:
~# lpadmin -p Roger-Router-Fax -m drv:///sample.drv/generic.ppd -v socket://localhost:9100/ -E -o PageSize=A4..
lpadmin: Printer drivers are deprecated and will stop working in a future version of CUPS.
Hintergrund: für den Fax-Betrieb mit Roger-Router muß ein virtueller Drucker eingerichtet werden. Scheint also nur eine Frage der Zeit zu sein …
weitere Artikel
- Debian Versionsupdate: Bullseye nach Bookworm
- Die neue Linux-Distribution - ein 'Rolling-Release'?
- Linux-Installation (Debian) mit verschlüsseltem Datenträger (LUKS, LVM)
- Defekte Pakete in Debian Sid
- Linux: Der Zufallsgenerator Calamares Installer
